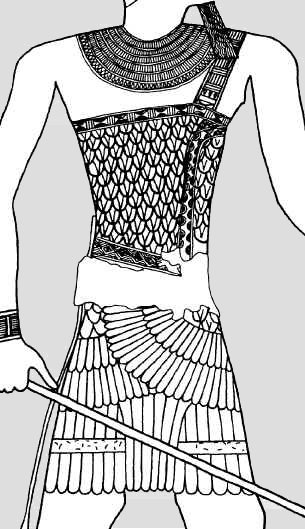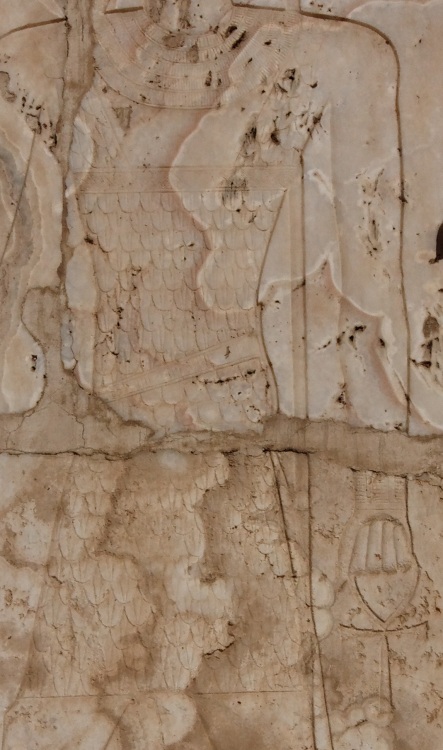|
Maat-ka-Ra Hatschepsut |
last update:
15.09.2011
|
| |
Königliches Federkleid |
|
| Zu den interessanten Ornaten bei der Darstellung des Königs in
der 18. Dynastie gehört das Federkleid. In voller Ausführung macht es nicht nur
einen überaus prächtigen Eindruck, sondern verleiht dem Träger auch wichtige
symbolische Bedeutung, in dem es ihn mit dem göttlichen Falken und dem
göttlichen Geier verbindet. |
| Nach Giza-Podgórski (1984) ist die Bedeutung des königlichen
Federkleides noch nicht ausreichend wissenschaftlich bearbeitet, obwohl Elemente
von Federn häufig in der Ikonographie und als dekoratives Element eingesetzt
werden. Er verweist in seiner Arbeit auf die wenigen Publikationen, die das
königliche Federkleid erwähnen oder gar seine Bedeutung zu erfassen suchen. |
| Die meisten Besucher werden in den Darstellungen auf Tempel-
oder Grabwänden keinen König im Federkleid zu sehen bekommen (entweder ist die Stätte nicht
zugänglich, oder das Ornat ist nicht als Federkleid zu erkennen, da es nur teilweise
ausgeführt wurde, etc.). |
| Die eindrucksvollsten Darstellungen eines Königs im
Federkleid aus der 18. Dynastie finden sich: |
| - auf der südlichen Außenwand des restaurierten Alabaster-Schreins
von Amenhotep I., der heute im Open Air-Museum (OAM) von Karnak aufgestellt ist.
|
| - zwei weitere Darstellungen befinden sich im Tempel der Hatschepsut in Deir
el-Bahari rechts und links an den Seitenwänden des Granitportals, das den
Eingang zum Hauptsanktuar des Amun auf Oberen Terrasse bildet. |
| Alle diese Darstellungen waren bisher für Besucher erreichbar
oder sichtbar (für die beiden Darstellungen am Granit-Portal des Tempels in Deir
el-Bahari ist allerdings der Einsatz eines Fernglases notwendig). |
| Alabaster-Kapelle Amenhotep I. im Open Air-Museum |
| Die südliche Außenwand des Alabaster-Sanktuars Amenhotep I. zeigt
in der Szene ganz links Thutmosis I. beim Treiben der 4 Kälber vor dem
ithyphallischen Amun. Thutmosis I. trägt in dieser Szene ein ausgezeichnet
erhaltenes Federkleid (siehe unten), nur im mittleren Teil - auf der Höhe des Gürtels - sind Teile
der Darstellung verloren gegangen. |

| Federkleid Thutmosis I. (südliche Außenwand des
Alabaster-Sanktuars von Amenhotep I.). |
| Das Kleid besteht aus einem Oberteil (Mieder), das 2/3 des
unteren Oberkörpers bedeckt. Das Oberteil wird gehalten von einem einzigen
Riemen, der am oberen Abschlussband des Oberteil festgemacht wurde. Das Band ist
mit Längs- und Querstreifen sowie einem nb-Zeichen
an der Verbindung zum Oberteil dekoriert. |

| Ein Band in Form eines altägyptischen Breitbeils bildet den
Abschluss des oberen Miederteils, ein weiteres Band in dieser Form teilt das
Oberteil auf der linken Brustseite von oben nach unten in zwei Teile. Das obere
Band ist mit Querstreifen und Kreissegmenten dekoriert, das senkrechte Band mit
Halbkreisen. |

| Die breiten und runden, V-förmigen Federn des Oberteils überdecken einander wie Schuppen. |
| Das Oberteil reicht rechts und links bis unter den schräg nach vorn abfallenden
Gürtel ab (siehe folgende und übernächste Abbildung), der mit einem Zick-Zack-Muster verziert ist.
Im mittleren Teil unterhalb des Gürtels ist die Darstellung zerstört, so dass
keine Aussage über die Ausdehnung des Oberteils gemacht werden kann. |

| Der Rock (siehe Foto oben) besteht aus mehreren Lagen langer,
schmaler, am Ende fast gerade abgeschnittener Federn. Deutlich erkennt man zwei
Viertelkreise von Federn, die sich vom Gürtel abwärts um die Hüften legen. |

| Detailfoto des oberen Rockteils, mit Resten des
Oberkleides rechts und links unterhalb des Gürtels und den beiden Viertelkreisen aus langen, schmalen Federn. |
| Unter den Viertelkreisen reicht eine Lage von langen,
schmalen Federn senkrecht bis fast zu den Knien - diese Lage wird durch ein
horizontales Band zusammengehalten.
|
| Eine weitere, Schwanz-förmige, sich nach unten verjüngende Lage
von langen, schmalen Federn tritt unter den Viertelkreisen hervor und reicht
über die untere Lage mit dem horizontalen Band bis zum Rocksaum.
Dazu trägt Thutmosis I. natürlich den königlichen Stierschwanz. |
| Die folgende Zeichnung von Giza-Podgórski (1984) zeigt noch
einmal die
gesamte Darstellung Thutmosis I. im Federkleid. |
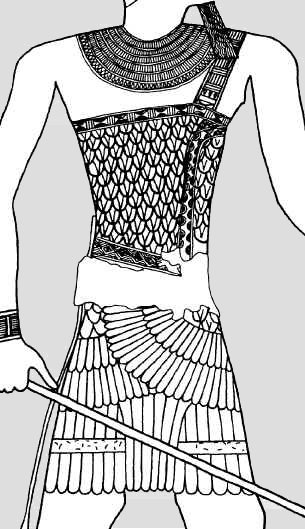
| Thutmosis I. im Federkleid beim Treiben der 4 Kälber auf dem Alabaster-Sanktuar
Amenhotep I. (Zeichnung aus: Giza-Podgórski, Abb. 2). |
| In der folgenden Szene der gleichen Wand trägt Thutmosis I. beim Ruderlauf vor
den schreitenden Amun einen ähnlichen Federrock wie in der oben beschriebenen
Szene (siehe folgende Abbildung), lediglich die untere Lage an Federn fehlt. |
| Der Oberkörper des Königs ist jedoch durch Verfärbungen und Schäden im
Stein so verändert, dass keine Aussage über die Gestaltung des Oberkleides
möglich ist. |

| Völlig anders ist dagegen die Gestaltung des Federkleides des
schreitenden Amun in der Szene des Ruderlaufes. Das Federkleid des Gottes
besteht durchgehend aus kurzen, breiten Federn. Darüber hinaus fehlt jegliche
Unterteilung des Kleides - mit Ausnahme eines Gürtels und eines oberen
Abschlussbandes - wie sie beim Federkleid Thutmosis I. (in der vorangehenden Szene "Treiben
der 4 Kälber") zu sehen ist. |
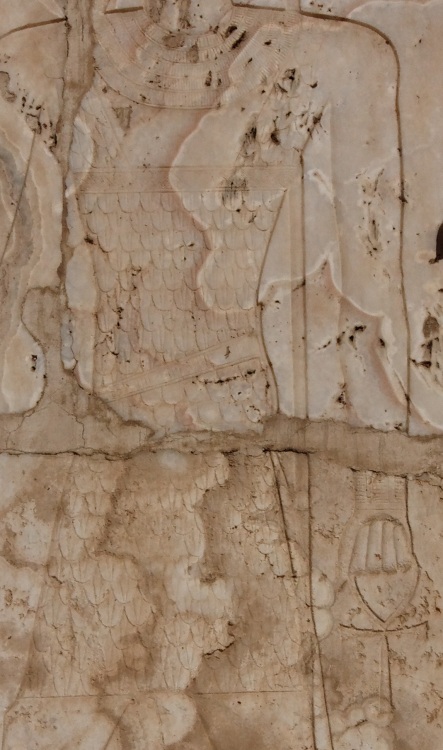
| Granit-Portal im Tempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari |
| Das Granit-Portal, das auf der 3. Terrasse den Eingang zum
Hauptsanktuar des Amun bildet,
zeigt auf beiden Seiten je eine Darstellung der Hatschepsut (Kartuschen auf Thutmosis III. geändert).
In beiden Darstellungen trägt die Königin ein ähnliches Ornat, die Darstellungen unterscheiden sich
lediglich durch den Kopfschmuck (auf der Südseite des Tores trägt sie die Weiße Krone von Oberägypten,
auf der Nordseite die Rote Krone von Unterägypten).
|
 |
|
Die Königin trägt ein gefiedertes
Oberteil mit kleinen V-förmigen Federn. Das Oberteil schließt oben mit einem
Band ab, das von 2 Trägern gehalten wird. Unten endet das Oberteil am nicht
dekorierten Gürtel.
Der Rock ist weniger eindeutig gegliedert, scheint aber aus langen Federn zu
bestehen, die an den Körperseiten über die Knie hinaus reichen.
Dazu trägt die Königin eine Frontschürze, möglicherweise mit einer beschlagenen
Felltasche - und natürlich den königlichen Stierschwanz.
Foto links: Darstellung auf der Südseite des Granit-Portals |
| Kleiner Tempel des Amun in Medinet Habu |
 |
|
Der König trägt hier ein Federkleid, das in seinen
Komponenten sehr der Darstellung Thutmosis I. auf der Alabaster-Kapelle
Amenhotep I. ähnelt.
An einigen Stellen haben sich die Farben sehr gut erhalten und zeigen grün-blaue
Federn mit roten Enden.
|
| Abstrahierte Darstellungen |
| Bereits zu Zeiten der Hatschepsut finden sich z. B. auf der
Roten Kapelle Darstellungen des Königs im Federkleid, die nur noch an der
äußeren Form als Federkleid zu erkennen sind, aber keine Federn mehr zeigen.
Möglicherweise wurden diese nicht mehr detailliert im Relief herausgearbeitet, sondern nur noch
aufgemalt. |

| Block 172 auf der südlichen Außenwand der Roten Kapelle zeigt
in der linken Szene Hatschepsut, geführt von Amun (rechts) und Atum (links). |
|

|
|
Block 173 auf der
Westseite der Kapelle zeigt Hatschepsut, die vier Kälber vor dem ithyphallischen
Amun weiht.
Das Foto links zeigt die Königin in vollem Ornat. Auch hier erkennt Giza-Podgórski ein stilistisch reduziertes
Federkleid. |
|
 |
|
Oberhalb der Nische B in der westlichen Wand
der 3. Terrasse ihres Tempels in Deir el-Bahari ist Hatschepsut (Kartusche
geändert auf Thutmosis II.) beim Treiben der vier Kälber vor dem ithyphallischen
Amun dargestellt.
Auch hier trägt sie nach Giza-Podgórski ein stilisiertes Federkleid.
|
| Königliches Feder- oder Falkenkleid |
| Die hier präsentierte Übersicht und zahlreiche weitere, von
Giza-Podgórski aufgeführte Beispiele zeigen, dass Federkleid und Federelemente
in der königlichen Ikonographie der 18. Dynastie eine bedeutende Rolle gespielt
haben dürften. |
| Naheliegend scheint hier die Identifikation des "Königs im
Federkleid" mit Horus zu sein, die ja die wichtigste Legitimation der königlichen
Macht war.
|
| Das Feder- oder Falkenkleid ("Horus dress") besteht komplett aus
Federn, und wird durch einen Gürtel in ein Ober- und Unterkleid geteilt. |
| Das Oberkleid besteht aus kurzen, breiten Federn und wird
von einem, gelegentlich auch von zwei Schulterbändern gehalten. Nach oben
schließt es häufig mit einem Band ab und ist zu dem durch ein weiteres Band
vertikal geteilt. Beide Bänder können gelegentlich die Form eines altägyptischen
Breitbeils haben.
|
| Das Unterteil besteht aus langen Federn und ist häufig durch
ein horizontales Band geteilt.
|
| Das Kleid wird komplettiert durch einen Stierschwanz. |
| Die Verteilung der Federtypen ähnelt der Verteilung auf dem
Falkenkörper - die kurzen breiten Federn bedecken den (Ober-)Körper, die langen
schmalen Federn entsprechen denen der Schwingen und des Schwanzes. Ein
geeigneter Vergleich sind hierzu die Falken, die auf den Balustraden der Rampe
zur 3. Terrasse des Tempels der Hatschepsut in Deir el-Bahari dargestellt sind
(siehe folgende Abbildung). |

| Horus auf der südlichen Balustrade der Rampe, die von der 2.
zur 3. Terrasse führt. Der Falke trägt im Brustbereich kurze breite Federn, die
Federn der Schwingen und des Schwanzes sind lang und schmal. |
| Nach Giza-Podgórski wird das Falken- oder Horuskleid
ausschließlich von schreitenden Königen der 18. Dynastie getragen. Mit einer
Ausnahme - im Grabe Amenhotep III. - finden sich Darstellungen des Königs im
Falkenkleid nur an Tempelwänden.
|
| Nach den Untersuchungen von Giza-Podgórski tritt die
Darstellung des Königs im Feder- oder Falkenkleid in etwa gleicher Häufigkeit
bei Szenen auf, in denen der König von Göttern geführt wird (in 12 von 34
Szenen) und beim Treiben der 4 Kälber (11/34), alle andere Szenen sind in
deutlich geringerer Häufigkeit vertreten.
|
| In insgesamt 14 von 34 Szenen trägt der König zum Federkleid
eine Atef-Krone, in 6 Fällen das Jbs-Kopftuch, alle
anderen Kronen treten mit vernachlässigbarer Häufigkeit auf bzw. waren nicht
identifizierbar (8/34). |
|